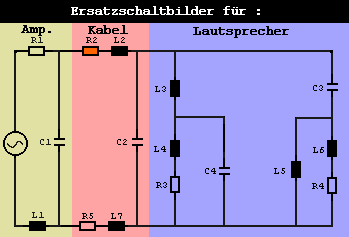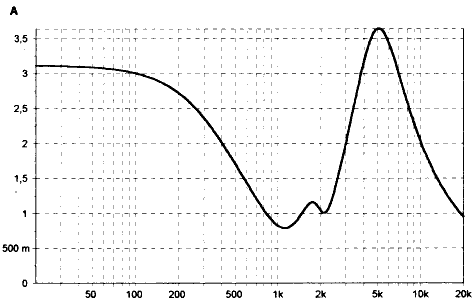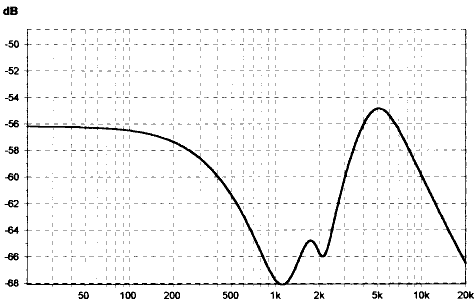Die Lautsprecherkabel ...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .... sollen möglichst verlustfrei und ohne eigene Klangfärbung das Signal vom Endverstärker zur Lautsprecherbox transportieren. Da wir aber in einer realen physikalischen Welt leben, geht nichts ohne Verluste vor sich, auch nicht der Transport des elektrischen Stroms in einem Kabel. Dabei sind 4 Parameter bestimmend für die Art der Verluste. 1. Der Widerstand Er ist eine Materialkonstante. Verschiedene Materialien haben verschiedene Widerstände. Der beste Leiter ist Silber, gefolgt von Kupfer. Silber leitet etwa 15% besser als Kupfer, ist aber um ein vielfaches teurer und schwieriger zu verarbeiten. Je länger ein Leiter, desto größer sein Widerstand. Je größer der Querschnitt eines Leiters, desto niedriger ist sein Widerstand. 2. Die Ableitung Da es keinen idealen Isolator gibt, wird bei einer zweidrähtigen Leitung immer ein Strom vom Leiter mit dem höheren Potential zu dem mit dem niedrigeren Potential fließen. Da in Lautsprecherkabeln grundsätzlich Wechselstrom fließt, wird dieser Zustand mit der Frequenz des Stromes wechseln. Dabei wird eine Verlustleistung im Kabel erzeugt, ähnlich wie durch den Verlustfaktor eines Kondensators. Diese sogenannten dielektrischen Verluste sind vom Material und der Dicke des Isolators abhängig. Teflon besitzt zum Beispiel hervorragende dielektrische Eigenschaften. 3. Die Kapazität Sie ist eine Eigenschaft eines Zweileitersystems, die immer dann auftritt, wenn der Hin- und Rückleiter über längere Strecken relativ dicht nebeneinander verlaufen. Sie wird fast unmeßbar klein, wenn für die Leiter kein gemeinsamer Isolator verwandt wird und der Leiterabstand mehr als einige Zentimeter beträgt. 4. Die Induktivität Induktivität ist eine Eigenschaft, die jeder Leiter aufweist, gleichgültig, aus welchem Material er gefertigt ist. Sie ist eine Folge des den Leiter durchfließenden Stromes. Induktivität hat eine Folgeerscheinung, die sogenannte Selbstinduktivität. Diese tritt immer als Begleiterscheinung von Wechselstömen und den daraus resultierenden Magnetfeldern auf. Diese Magnetfelder sind in Richtung und Betrag dem Wechelstrom, der durch das Lautsprecherkabel fließt, proportional. Bei ihrer Entstehung durchdringen sie immer den eigenen Leiter und erzeugen dadurch ebenfalls einen Strom, der aber seinem Entstehungsvorgang entgegengerichtet ist, den sogenannten Selbstinduktionsstrom. Dies ist ein streng von der Geometrie des Leiters abhängiger Vorgang und funktioniert nur perfekt, wenn der Leiter weitgehend gradlinig ist. Der Strom erzeugt also sein eigenes Hindernis, welches aber immer vom Betrag etwas kleiner ist als sein Erzeuger, da sonst überhaupt kein Strom fließen würde. Dieser Mechanismus hat bei Übertragungen von Tonfrequenz einen großen Einfluß auf die Wiedergabe von kleinen und kleinsten Signalen, welche in großem Maße die Raum- und Strukturinformationen beinhalten. Wie soll nun das ideale Lautsprecherkabel beschaffen sein? Es gibt dafür keine allgemeine Aussage. Es ist abhängig vom Verstärker und der Lautsprecherbox. Da in der heutigen Zeit Transistorverstärker den Ton angeben, sollte man davon ausgehen, daß der Ausgangswiderstand dieser Geräte sehr niedrig ist. Eine Wert von 0,05 Ohm ist sicherlich nicht als unerreichbar anzusehen, wenn er niedriger ausfällt, ist es umso besser. Dieser Wert sollte auch zu den hohen Frequenzen hin nicht wesentlich ansteigen. Je niedriger der Wert, desto höher der Dämpfungsfaktor der Endstufe. Der rechnerische Zusammenhang zwischen Ausgangswiderstand der Endstufe und Dämpfungsfaktor ist folgender: Lautsprecherwiderstand / Verstärkerausgangswiderstand = Dämpfungsfaktor Dabei werden folgende Werte zugrundegelegt: Lautsprecherwiderstand 8 Ohm Verstärkerausgangswiderstand in Ohm Dämpfungsfaktor = dimensionslose Zahl Es ist sicherlich schwer möglich, den Ausgangswiderstand einer Röhrenendstufe wesentlich unter 0,5 Ohm zu drücken, da der Innenwiderstand des Ausgangstransformators hier die entscheidende Rolle spielt. Welche Rolle spielt nun der Dämpfungsfaktor und wie hängt er mit den Kabeleigenschaften zusammen? Jeder Lautsprecher tendiert als schwingfähiges System zu Eigenschwingungen. Diese stellen sich in der Musikreproduktion als unerwünschte Klangeinfärbungen dar, die erheblich die Exaktheit und Räumlichkeit einer Wiedergabe beeinflussen. Die Eigenschwingungen erzeugen wiederum einen Selbstinduktionsstrom ( siehe oben), der durch den niederohmigen Verstärker kurzgeschlossen wird. Das funktioniert umso besser, je gößer der Kurzschluß ist, also je geringer der Widerstandswert, der vom Verstärker geboten wird, ist. Erreicht der Widerstandswert des Kabels (Hin- und Rückleiter zusammenaddiert) den Wert des Verstärkerausgangswiderstandes, so wird der Dämpfungsfaktor halbiert. Also ist also der absolute, ohmsche Wert eines Lautsprecherkabels für die allgemeine Kontrolle über einen Lautsprecher zuständig. Daraus folgt: Je kürzer das Kabel, desto besser die Kontrolle, oder: Eigentlich gehört der Verstärker in die Lautsprecherbox! Hinzu kommt der frequenzabhängige Anteil der Impedanz, die ein Lautsprecherkabel besitzt. Jedes Kabel hat einen gewissen Anteil der obig beschriebenen Eigenschaften. Manche Hersteller gehen dazu über, Induktivität oder Kapazität mittels Kondensatoren oder Spulen zu kompensieren. Das funktioniert leider nur im stationären Zustand oder weniger technisch ausgdrückt, wenn das System eingeschwungen ist. Dies ist ein System aber immer dann, wenn es mit konstanter Amplitude immer die gleiche Frequenz verarbeitet. Wer mag aber schon einen dauernden Sinuston hören? Zusätzlich varriert das Signal zwischen Vollpegel und bis zu -60 dB. Das ist im musikalischen Geschehen völlig normal. Dabei ist zu untersuchen, ob das Grossignalverhalten eines Kabels identisch mit seinem Kleinsignalverhalten ist. Ich bezweifele, ob dieses viele Hersteller machen. Das frequenzabhängige Verhalten eines Lautsprechers kommt zu allem erschwerend hinzu. Stellen Sie sich eine Lautsprecherbox als Bassreflexbox vor. Wir nehmen mal einfach an, sie hätte ihr Impedanzminimum bei 50 Hz, und weil der Entwickler etwas geschlampt hat, beträgt dieses auch noch 1,5 Ohm. Im Übergangsbereich zum Mitteltöner ist der Wert aber schon auf etwa 30 Ohm angewachsen. Ein Musiker spielt einen Kontrabass, mal tief gestrichen und dann wieder gezupft. Alle Töne sind gleich laut, der Verstärker will sie also mit gleicher Leistung reproduzieren, und das bedeutet mit gleicher Spannung! Ein gezupfter Bass liegt sicherlich bei ca. 600 Hertz, also schon im Bereich der Mitteltöne. Gestrichen erreicht er ohne weiteres die 50 Hz. Verstärker und Kabel erzeugen und befördern also Ströme, die im tiefsten Bereich 15 mal größer sind als im Mittenbereich, und das bei der Wiedergabe einen einzigen Instruments über einen kleinen tonalen Bereich. Nach all der Theorie jetzt mal anschaulich : Wissen Sie eigentlich, was Ihr Verstärker und das Kabel zu leisten haben, oder was sich in beiden abspielt, wenn eine normale Zweiweglautsprecherbox damit betrieben wird? Als Demonstrationsbeispiel sollen ein Vollverstärker und 5 m Lautsprecherkabel dienen. Der Widerstand des Kabels wird pro einzelner Strecke mit 5 mOhm angenommen, was ein verdammt geringer Wert ist. Die Induktivität ist mit 20 µH auch nicht zu hoch und die Kapazität soll 100 pF/m betragen, was 500 pF ergibt. So sieht (stark) vereinfacht das elektrische Gebilde Verstärker (Amp.), Lautsprecherkabel und Lautsprecherbox aus :
Der rechte Teil des Schaltbildes mit L3 bis L6, C3 und R3 bis R4 stellen ein eher harmloses Gebilde an Lautsprecherbox dar, mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm. Gemessen wird mit 25 Watt Leistung, wohl nicht zuviel. Als Meßstelle fungiert der ohmsche Widerstand des Kabels, der keine Frequenzveränderung hervorruft. Die Resultate sieht man in den Grafiken. Der Strom variiert etwa um den Faktor 5 und die Verstärkung um ca. 14 dB. Das sind durchaus realistische Werte, die meinen Ruf nach Aktivlautsprechern nur bestätigen! Strom durch das Lautsprecherkabel :
Verstärkung :
Ein weiterer Punkt sind die Übergangswiderstände. Diese sollten beim Anschluß von Lautsprecherkabeln in jedem Fall vermieden werden. Wenn`s geht, sollte man Stecker verwenden. Muß man auf Kabelschuhe zurückgreifen, sollte man den Typen aus verzinntem Weichkupfer den Vorzug geben. Vergoldete Messingkabelschuhe verkratzen sowiso nur beim Andrehen und geben wegen der Unnachgiebigkeit des relativ harten Messings keinen guten Kontakt mit der Schraubklemme. Das verführt zum übermäßig starken Andrehen der Klemmen und oft zu deren Zerstörung. Auf keinen Fall dünne Kabeladern unter die Klemme schieben und dann zudrehen. Die Drähte ziehen sich in das Gewinde und zerstören es. Benutzen Sie immer das meistens vorhandene Querloch. |